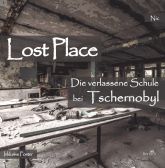Blickfang am Frauenplan
Am Frauenplan, direkt gegenüber dem Wohnhaus Johann Wolfgang von Goethes, steht ein nach ihm benannter markanter Brunnen. Es ist einer von zwei gusseisernen Brunnen, die der Stadtbaumeister Coudray bei der Gießerei Günstersfeld in Ilmenau in Auftrag gegeben hatte. Auf steinernen Sockeln stehend bilden die den Brunnen umrahmenden Eisenplatten ein Achteck, an dessen dem Goethehaus abgewandten hinteren Teil sich eine Säule erhebt, aus der das Wasser durch die Figur eines speiernden Delfins in das Brunnenbecken einfließt. Platten und Säule sind von grüner Farbe.
In der Mitte einer jeden Eisenplatte ist das Bild einer von einem Blätterkranz umgebenen trinkenden Schlange eingeprägt. Die Schlange galt als Symbol von Lebenskraft, Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit. Auf einer der Platten ist die Zahl 1821 eingeprägt, das Jahr, in dem der Brunnen errichtet wurde.
Auf der Säule finden sich die Initialen CA von Erzherzog Carl August sowie eine Krone, auf der Rückfront der Säule umrahmt von einem Eichenlaubkranz die Jahreszahl 1822 . Der wasserspeiernde Delfin ist mit einem Dreizack ausgestattet.
Die Brunnen hatten zu dieser Zeit eine große Bedeutung für die Wasserversorgung der Weimarer Bevölkerung. Erst 1882-84 wurde ein erstes Leitungssystem installiert, über das auch private Grundstücke und Haushalte versorgt wurden. Bis dahin mussten sich die Bürger aus den öffentlichen Brunnen bedienen. Sie waren damit zugleich Treffpunkte. Wie ein Brief Goethes bezeugt, beobachtete er das Treiben am Brunnen vor seinem Haus mit regem Interesse.
*****
Literatur:
Gitta Günther, Wolfram Huschke und Walter Steiner (Hrsg.), Weimar, Lexikon der Stadtgeschichte. Verlag Hermann Böhlau Nachfolger, Weimar 1998
Fotos: Rita Dadder